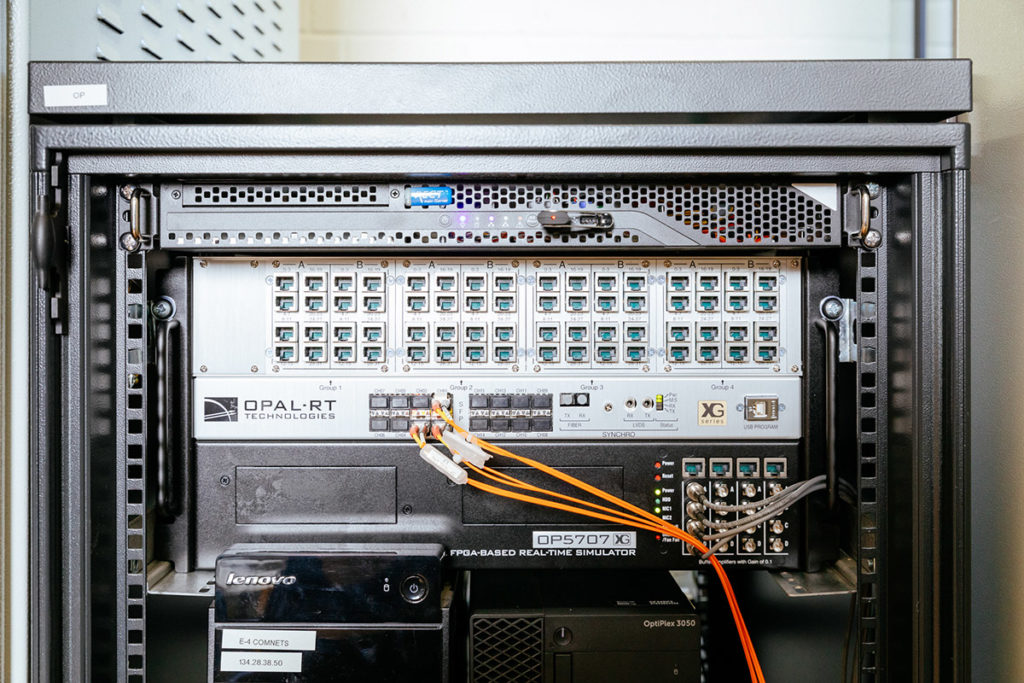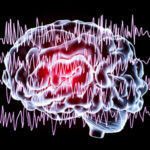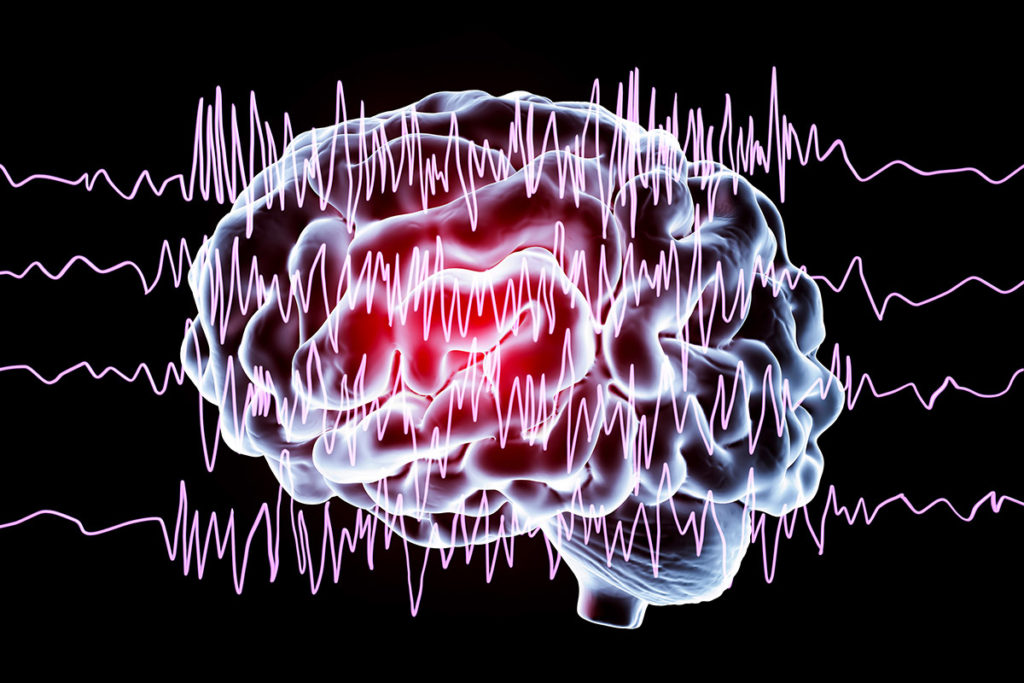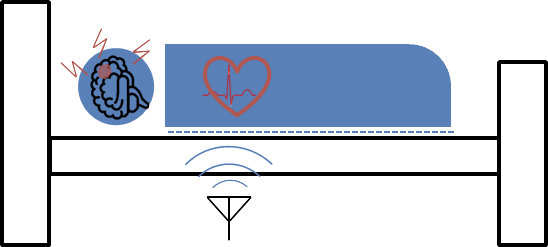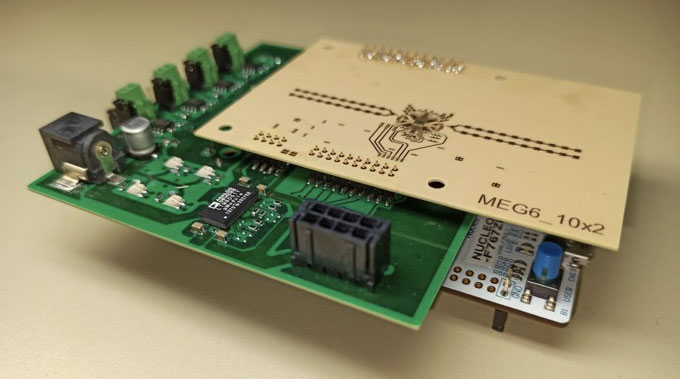Zwischen Juni und August 2022 konnten Fahrgäste für neun Euro im Monat bundesweit im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) reisen.

Mit dem 9-Euro-Ticket in Bus und Bahn
In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Verkehrsverbund (hvv) untersuchen Christoph Aberle und sein Team vom Institut für Verkehrsplanung und Logistik der TU Hamburg, welche Auswirkungen das Angebot auf einkommensarme Menschen hatte.

Was erhoffen Sie sich von den Interviews?
Wir befragen 30 Personen, die von weniger als 900 Euro im Monat leben. Damit ergänzen wir quantitative Erhebungen, beispielsweise des hvv, mit einem Fokus auf Menschen in Armut. Die Antworten der Betroffenen helfen uns, soziale Ausgrenzung besser zu verstehen und politische Maßnahmen zu empfehlen. Letztendlich wollen wir Mobilitätsarmut bekämpfen und Möglichkeitsräume für Betroffene eröffnen und erweitern.
Foto: Canva
Nutzen die Menschen den ÖPNV durch das 9-Euro-Ticket verstärkt?
Eindeutig ja. Die Befragten sind begeistert von der Einfachheit des 9-Euro-Tickets. Richtig weite Fahrten machen sie kaum, was zum Ergebnis einer hvv-Befragung passt. Vor allem Alltagswege werden häufiger zurückgelegt. Aber die Chance, mal günstig ans Meer zu kommen, nutzen sie natürlich. Um das mal preislich einzuordnen: Eine Person hat mit „Hartz IV“ nur 41 Euro im Monat für den Verkehr zur Verfügung. Im Mittel überschreiten Betroffene dieses Budget fast um das Doppelte. Der ÖPNV ist für die meisten schlichtweg zu teuer. Zwar gibt es Möglichkeiten, für kleines Geld in Hamburg mobil zu sein, aber dann müssen sie sich den Sperrzeiten und Zonengrenzen unterordnen. Das verursacht Probleme, zum Beispiel wenn ein Arzttermin in der Sperrzeit ansteht.
Sollte es das Ticket dann nicht dauerhaft geben?
Allgemein bewerte ich das 9-Euro-Ticket aus zwei Gründen kritisch. Erstens verfolgt die kurzfristige Maßnahme keine strategischen Ziele. So bleibt etwa der Individualverkehr gegenüber dem ÖPNV weiterhin attraktiv, weil es gleichzeitig den ‚Tankrabatt‘ gibt. Zweitens befürchte ich, ein bundesweiter quasi-Nulltarif führt zu mehr Verkehr und zur weiteren Ausbreitung von Siedlungen. Dabei wäre eigentlich Verkehrsvermeidung angesagt, wenn wir unsere Klimaziele ernst nähmen. Menschen in Armut allerdings werden massiv entlastet. Sie können sich, was für viele selbstverständlich ist, sorglos im Nahverkehr bewegen. Hier sehe ich einen absoluten Gewinn an Teilhabechance – und plädiere dafür, ihnen ein ähnlich günstiges Angebot zu machen. Ein Ticket für den ganzen Stadtraum ohne Sperrzeit für 30 Euro wäre ein Anfang.
Weitere Informationen zum Thema unter www.stadtarmmobil.de sowie unter www.mobileinclusion.de

Foto: Carolin Büttner